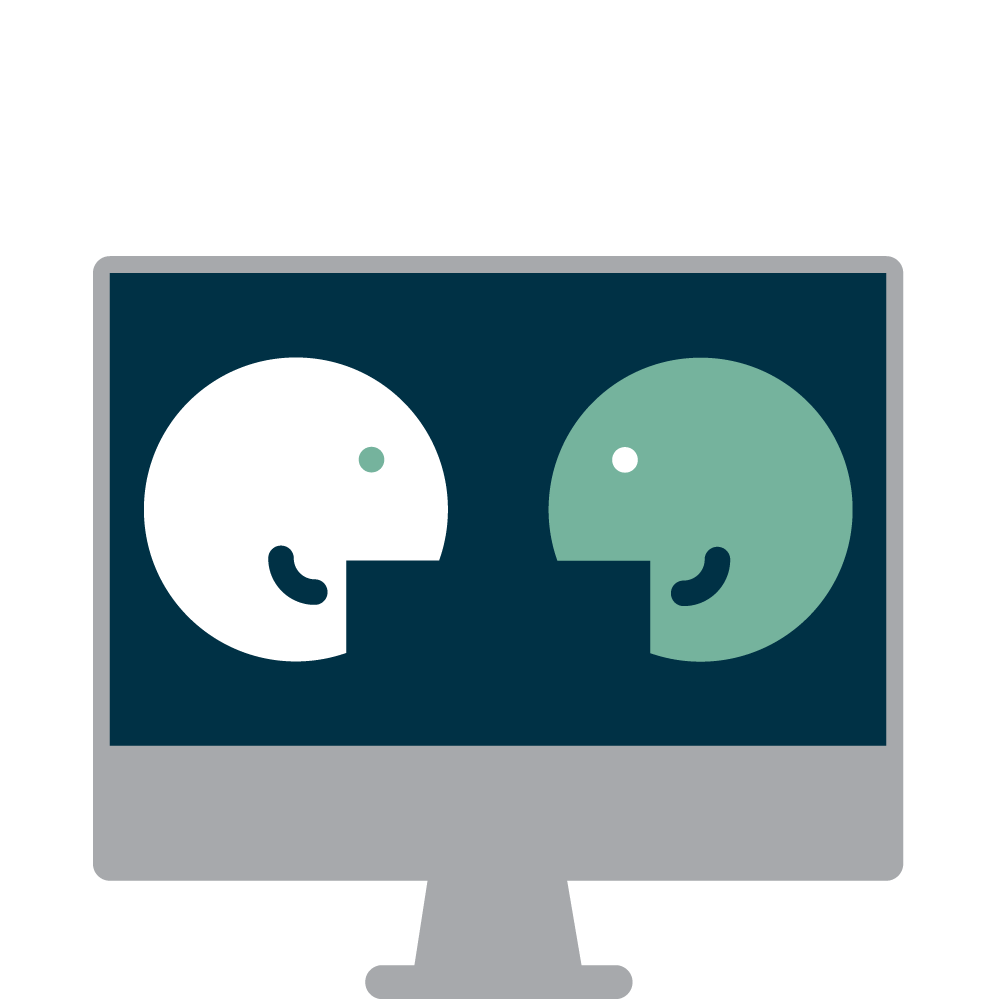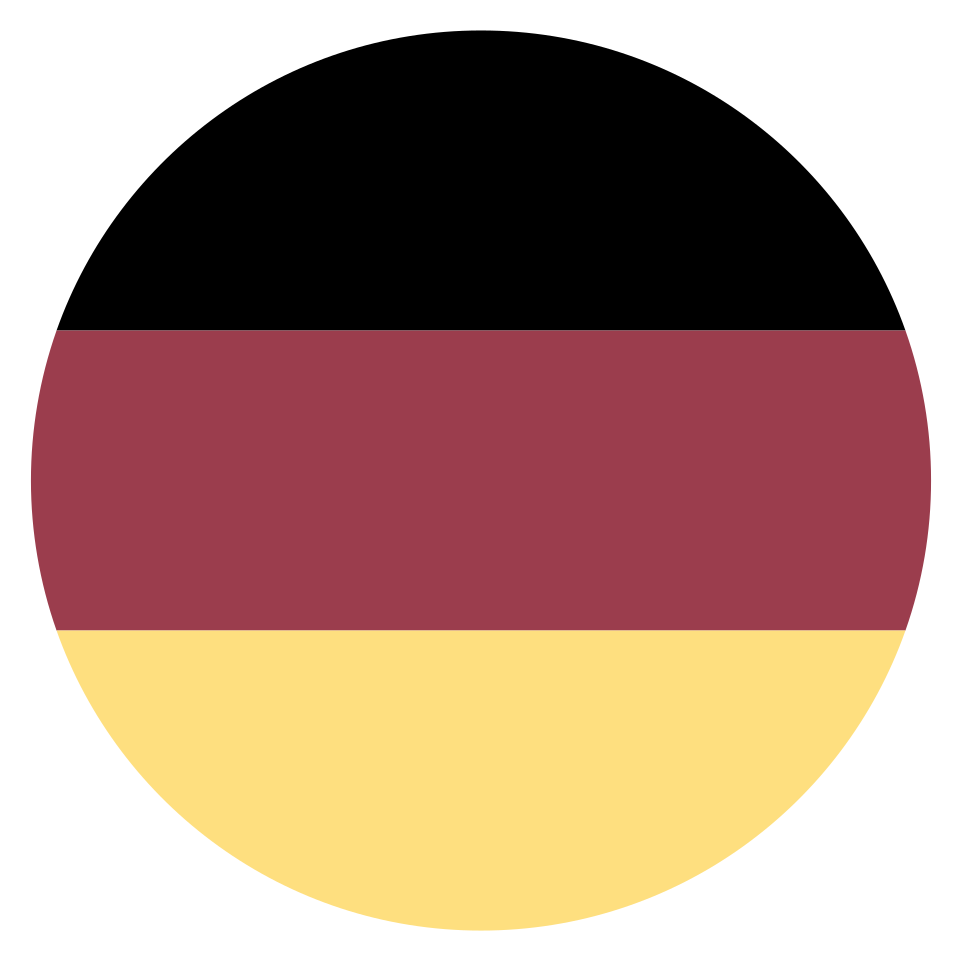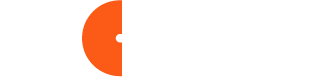Grüner Wasserstoff – was bei der Genehmigung eines Elektrolyseurs zu beachten ist (Update Februar 2025)
Veröffentlicht am 7th Februar 2025

Hintergrund
In Elektrolyseuren wird Wasser unter Einsatz von Strom mittels Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Als „grüner“ Wasserstoff wird der erzeugte Wasserstoff nur dann bezeichnet, wenn der eingesetzte Strom nachweisbar ausschließlich aus erneuerbaren Quellen stammt. Die genauen Anforderungen an den eingesetzten Strom ergeben sich insbesondere aus der Delegierten Verordnung (EU) 2023/1184 der EU-Kommission.
Die ausreichende Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff gilt als Voraussetzung für die erfolgreiche Dekarbonisierung bestimmter Industrien sowie von Teilen des Verkehrs. Ausweislich der im Juli 2023 fortgeschriebenen Nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung soll ein Großteil des voraussichtlichen Wasserstoffbedarfes über Importe aus anderen EU-Mitgliedstaaten sowie internationalen Partnerländern abgedeckt werden. Daneben soll die inländische Elektrolysekapazität bis zum Jahr 2030 auf mindestens zehn Gigawatt erhöht werden.
Vor diesem Hintergrund hat der deutsche Gesetzgeber in den letzten Jahren diverse Anpassungen der planungs- und genehmigungsrechtlichen Anforderungen für Elektrolyseure vorgenommen, welche die Genehmigung von Elektrolyseuren erleichtern und beschleunigen sollen.
Regelfall: BImSchG-Genehmigung
Bis vor Kurzem galten grundsätzlich sämtliche gewerblich betriebenen Elektrolyseure unabhängig von ihrer Dimensionierung als Anlagen im Sinne der EU-Industrieemissions-Richtlinie 2010/75/EU (IED). Dies hatte zur Konsequenz, dass sie stets einer im förmlichen Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung erteilten Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) bedurften sowie zusätzlichen Anforderungen für Anlagen nach der IED unterlagen.
Genehmigungsrechtlich wurden selbst kleine Elektrolyseure somit genauso behandelt wie Erzeugungsanlagen, die Wasserstoff unter Einsatz von Erdgas herstellen. Diese mit Blick auf das unterschiedliche Risikoprofil der Anlagen wenig nachvollziehbare Rechtslage wurde im Jahr 2024 durch Anpassung der IED im August 2024 sowie der Vierten Verordnung zur Durchführung des BImSchG über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) im November 2024 geändert. Ob die Errichtung und der Betrieb eines Elektrolyseurs einer BImSchG-Genehmigung bedarf und in welchem Verfahren diese erteilt wird, hängt nunmehr davon ab, ob bestimmte Schwellenwerte erreicht werden.
- Erst ab einer Produktionskapazität von 50 Tonnen Wasserstoff pro Tag gelten Elektrolyseure weiterhin als Anlagen nach der IED und bedürfen der Durchführung eines förmlichen Verfahrens mit Öffentlichkeitsbeteiligung. Für das Verfahren gelten jedoch besondere Fristenregelungen für die Beteiligung der relevanten Fachbehörden, die der Verfahrensbeschleunigung dienen sollen.
- Unterhalb dieser Schwelle bedürfen Elektrolyseure ab einer elektrischen Nennleistung von fünf Megawatt (MW) zwar ebenfalls einer BImSchG-Genehmigung. Grundsätzlich ist hier aber die Durchführung eines vereinfachten Verfahrens ohne Öffentlichkeitsbeteiligung ausreichend.
Kleinere Elektrolyseure bedürfen dagegen mittlerweile keiner BImSchG-Genehmigung mehr. Stattdessen ist regelmäßig primär eine Baugenehmigung nach der einschlägigen Landesbauordnung erforderlich.
Grundsätzlich darf für die Zulassung eines Elektrolyseurs anstelle der BImSchG-Genehmigung ein fakultatives Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsverfahren beantragt werden (vgl. § 43 Abs. 2 S. 1 Nr. 7 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)). Ob dies sinnvoll sein könnte, ist für den jeweiligen Einzelfall zu beurteilen.
Umweltverträglichkeitsprüfung
Parallel zur Änderung der 4. BImSchV wurde im Oktober 2024 auch die Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) angepasst. Nach der neuen Rechtslage ist für (BImSchG-genehmigungsbedürftige) Elektrolyseure ab fünf MW elektrische Nennleistung eine überschlägige UVP-Vorprüfung (sog. Screening) durchzuführen. Für kleinere Elektrolyseure wird von einer solchen Vorprüfungspflicht abgesehen. Ab 50 MW ist eine allgemeine Vorprüfung erforderlich. Unterhalb dieses Schwellenwertes ist eine standortspezifische UVP-Vorprüfung ausreichend. Der Durchführung einer vollständigen UVP bedarf es nur, wenn die Behörde aufgrund der standortspezifischen bzw. allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles zu dem Ergebnis kommt, dass das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.
Im Einzelfall könnte eine UVP(-Vorprüfung) zudem etwa aufgrund des Umfangs der geplanten Entnahme von Grundwasser erforderlich sein. Die UVP(-Vorprüfung) sowie entsprechende Verfahrensanforderungen erfolgen integriert in das (BImSchG-)Zulassungsverfahren.
Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit
Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Elektrolyseurs ist wesentliche materielle Voraussetzung für die Genehmigungserteilung.
Im so genannten planungsrechtlichen Außenbereich sind Elektrolyseure grundsätzlich nur dann zulässig, wenn sie in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang mit einer im Außenbereich privilegierten Wind- oder PV-Stromerzeugungsanlage stehen. Näheres regelt die Sonderregelung des § 249a Baugesetzbuch (BauGB).
Sind die vorstehend genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, ist grundsätzlich ein Bebauungsplan erforderlich. In diesem Zusammenhang ist auf die in § 14 Abs. 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) enthaltenen Sonderregelungen für Elektrolyseure hinzuweisen.
Sonstige Genehmigungen
BImSchG-Genehmigungen schließen andere die Anlage betreffende behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentliche-rechtliche Genehmigungen, Zulassungen, Erlaubnisse und Bewilligungen mit ein (so genannte Konzentrationswirkung). Daher entfallen etwaige nach Fachrecht erforderliche weitere Zulassungen für den Elektrolyseur (z.B. nach Bauordnungsrecht, Betriebssicherheitsrecht, Naturschutzrecht), sofern ein BImSchG-Verfahren durchzuführen ist.
Dieser Grundsatz gilt jedoch nicht uneingeschränkt. Eine für Elektrolyseure unter Umständen wichtige Ausnahme betrifft gegebenenfalls erforderliche wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen, etwa für die Entnahme von Grundwasser oder für die Einleitung von Abwasser. Bei einem Bedarf von circa neun Litern Wasser pro Kilogramm Wasserstoff ist die Sicherung eines ausreichenden Wasserbezuges eine entscheidende Voraussetzung für den Erfolg eines Elektrolyseurprojektes.
Ergänzende technische Infrastruktur
Elektrolyseure werden typischerweise nicht isoliert errichtet, sondern in Kombination mit technischer Infrastruktur zur Speicherung und/oder zum Transport des produzierten Wasserstoffes. Die nachfolgenden Beispiele verdeutlichen, dass die planungs- und genehmigungsrechtlichen Anforderungen an diese ergänzenden technischen Komponenten im Zuge der Projektplanung ebenfalls frühzeitig in den Blick genommen werden sollten.
Oberirdische Anlagen zur Lagerung von Wasserstoff bedürfen ab einer Speicherkapazität von drei Tonnen Wasserstoff ebenfalls einer BImSchG-Genehmigung. Ab einer Speicherkapazität von 30 Tonnen ist die Durchführung eines förmlichen Verfahrens mit Öffentlichkeitsbeteiligung erforderlich, während unterhalb dieses Schwellenwertes ein vereinfachtes Verfahren ausreichend ist. Darüber hinaus unterliegen Wasserstoffspeicher bereits ab einer Speicherkapazität von fünf Tonnen zusätzlich störfallrechtlichen Anforderungen.
Wird ein Elektrolyseur (nur) mit einem oberirdischen Wasserstoffspeicher kombiniert, wird in der Regel ein einheitliches BImSchG-Verfahren für die „zusammengesetzte“ Anlage durchgeführt. Sofern dabei für mindestens eine der Komponenten das förmliche Verfahren einschlägig ist, wird ein förmliches Verfahren durchgeführt.
Eine unterirdische Speicherung des erzeugten Wasserstoffes ist beispielsweise durch Umrüstung bestehender unterirdischer Erdgasspeicher möglich. Die Zulassung der Errichtung und des Betriebes von Untergrundspeichern richtet sich nicht nach dem BImSchG, sondern nach dem Bundesberggesetz (BBergG).
Neue Leitungen zum Transport des erzeugten Wasserstoffes bedürfen ab einem Durchmesser von mehr als 30 Zentimetern grundsätzlich eines Planfeststellungsverfahrens (vgl. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 EnWG).
Für die Umwidmung bestehender Gasversorgungsleitungen für Erdgas gelten Sonderregelungen. In der Regel reicht hier die Durchführung eines Anzeigeverfahrens aus. Zudem entfällt eine erneute Umweltverträglichkeitsprüfung.
Ausblick
Die scheidende Bundesregierung hatte im Jahr 2024 weitere umfangreiche Anpassungen der planungs- und genehmigungsrechtlichen Anforderungen für Elektrolyseure und sonstige Wasserstoffinfrastruktur auf den Weg gebracht.
Zentrales und bedeutendes Gesetzesvorhaben war dabei das geplante Wasserstoffbeschleunigungsgesetz (WaBG) zur Förderung und Beschleunigung des Ausbaus von Wasserstofftechnologien.
Das WaBG sollte unter anderem das überragende öffentliche Interesse an hauptsächlich mit erneuerbar erzeugtem Strom betriebenen Elektrolyseuren festschreiben. Zudem waren zahlreiche Sonderregelungen zur weiteren Vereinfachung und Beschleunigung Zulassungsverfahren nach BImSchG sowie nach Wasserrecht vorgesehen.
Daneben sollten im Zuge der geplanten BauGB-Novelle zur Stärkung der integrierten Stadtentwicklungen weitere Erleichterungen für Elektrolyseure im Bereich des Planungsrechtes eingeführt werden.
Es bleibt abzuwarten, ob und inwieweit diese Vorhaben nach der anstehenden Bundestagswahl weiterverfolgt werden.
Den gesamten Artikel können Sie hier als pdf downloaden.