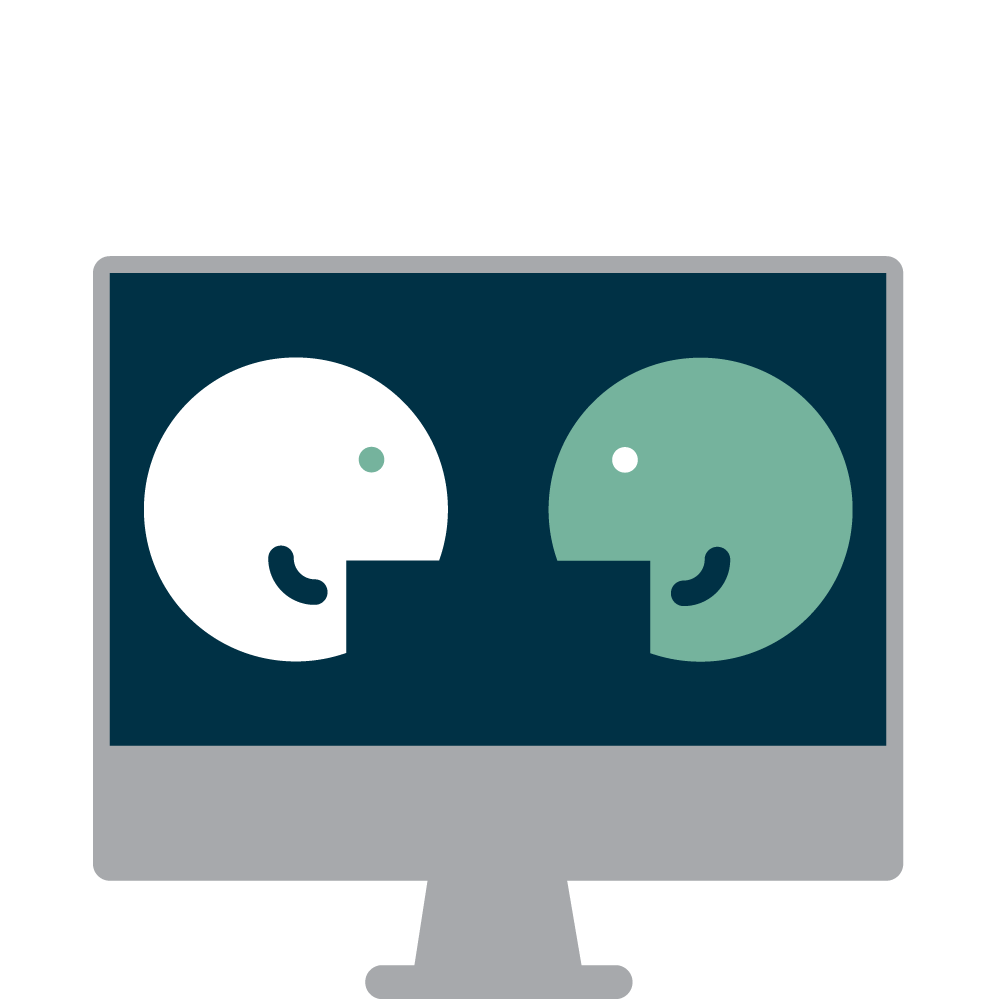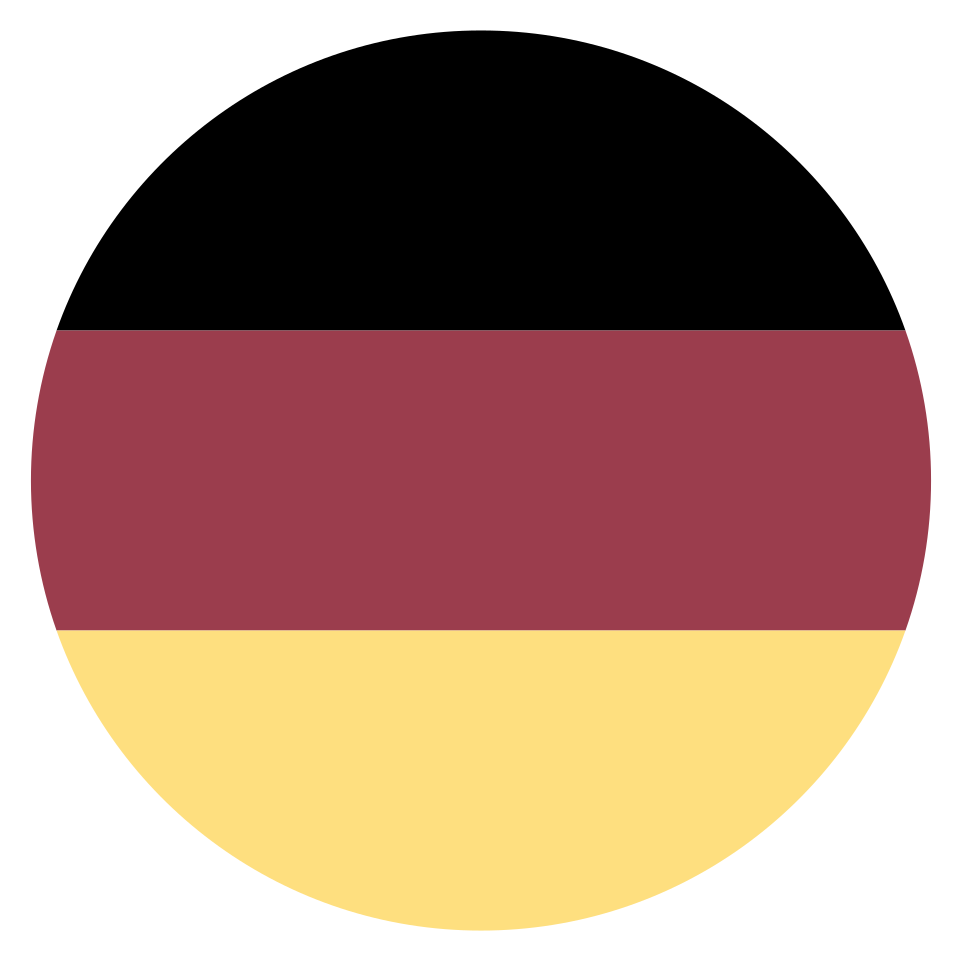Aufklärungspflichten beim Unternehmenskauf
Veröffentlicht am 10th Mai 2016
Jeder Verkäufer eines Gebrauchtwagens ist heute verpflichtet, den Käufer seines Fahrzeuges ungefragt über Unfallschäden zu informieren. Worüber aber muss der Verkäufer eines Unternehmens den Käufer aufklären? Muss auch er bei jedem Fahrzeug seines Unternehmens nachforschen, ob dieses einen Unfallschaden hatte? Ist diese Information im Zusammenhang mit einem Unternehmenskauf überhaupt von Relevanz? Was muss er über die finanzielle Lage des Unternehmens preisgeben? Wie sieht es mit den Rechtsbeziehungen zu Arbeitnehmern, Kunden oder Lieferanten aus? Und welche Rolle spielen gewerbliche Schutzrechte oder Rechtsstreitigkeiten?
Es wird schnell deutlich, dass man hier auf ein scheinbar uferloses Feld möglicher Informationspflichten stößt, über deren Bedeutung bei einem Unternehmenskauf man sich trefflich streiten kann. Offenkundig gibt es bei jedem Unternehmenskauf aber zahlreiche Faktoren, welche für die Beurteilung des Unternehmens und seines Kaufpreises von Bedeutung sind. Wie sieht hier die Rechtslage aus?
Ansicht des BGH, Bedeutung der Due Diligence
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass es eine Aufklärungspflicht nur über solche Umstände des Unternehmens gibt, die von „erheblicher“ Bedeutung für die Kaufentscheidung des Käufers und die Bemessung des Kaufpreises sind, sofern der Käufer diese Umstände nicht kennt und er mit einer solchen Information nach der Verkehrssitte rechnen konnte (BGH-Urteil vom 4.4.2001, VIII ZR 32/00).
Nach welchen Kriterien würde der BGH entscheiden, ob eine bestimmte Information für die Kaufentscheidung des Käufers oder den Kaufpreis von erheblicher Bedeutung ist? Welche „Verkehrssitte“ gibt es im Zusammenhang mit der Aufklärung bei einem Unternehmenskauf? Dazu schweigt der BGH in seiner Entscheidung.
In der Praxis hat die Frage weniger Bedeutung als man auf den ersten Blick vermuten würde. Es gibt nämlich heutzutage kaum noch ein Unternehmenskauf, bei welchem der Käufer dem Verkäufer nicht selbst einen detaillierten Fragenkatalog vorlegt (sog. Due-Diligence-Check-Liste). Der Verkäufer kann dann darauf vertrauen, dass der Käufer mit dieser Frageliste alle für ihn wesentlichen Fragen selber gestellt hat, so dass der Verkäufer in der Regel seinen Pflichten genügt, wenn er diese Fragen hinreichend beantwortet.
Sonstige Umstände?
Allerdings fragt man sich, ob es nicht trotz Vorlage von Due-Diligence Check-Listen doch noch Umstände geben könnte, über welche der Käufer zusätzlich aufgeklärt werden muss. Immerhin ist es ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass der Käufer aus Mangel an Kenntnissen über das Unternehmen Besonderheiten des Unternehmens übersieht, die wichtig für seine Kaufentscheidung sind. In diesem Fall muss er möglicherweise auf solche Umstände erst ausdrücklich aufmerksam gemacht werden. Jedenfalls erscheint es zu kurz gegriffen, sich einfach nur an der Frageliste des Käufers zu orientieren.
Der Verkäufer muss, darin sind sich alle Berater einig, trotz einer ihm vorgelegten Due-Diligence Checkliste jeweils prüfen, ob es nicht weitere Umstände gibt, die im Sinne der BGH-Rechtsprechung einen wesentlichen Einfluss auf die Entscheidung des Käufers zum Kauf haben. Z.B. eine gerade erst erfolgte Kündigung eines Großkunden, der Widerruf einer Betriebsgenehmigung oder der Eingang einer existenzbedrohenden Klage. Eine genaue Grenze, was der Verkäufer dem Käufer notfalls ungefragt offenzulegen hat, ist vom BGH zwar nicht gezogen worden, gerade, weil diese Grenze aber offen ist, sollte jeder Verkäufer aus Vorsichtsgründen alle Umstände offenlegen, die ihm, wäre er denn selber der Käufer, wichtig erscheinen. Maßstab ist die Beurteilung der Wichtigkeit solcher Informationen durch einen ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsführer. Man kann vor diesem Hintergrund einem Verkäufer nur empfehlen, sich die Brille des Käufers aufzusetzen. Im Zweifel würden Richter oder Schiedsrichter wohl auch diesen Maßstab anwenden, wenn es zum Streit kommt.
Zutreffender Inhalt der Aufklärung
Ein weiterer Aspekt der Aufklärung ist die Art und Weise, „wie“ sie zu erfolgen hat. Wenn dem Käufer Informationen gegeben werden, müssen diese nach der Rechtsprechung der BGH stets zutreffend und richtig sein. Dies gilt auch dann, wenn an sich keine originäre Aufklärungspflicht bestand. Diese Rechtslage ist Ausdruck des Vertrauenstatbestandes, den der Verkäufer durch die von ihm erteilten Auskünfte schafft. Der Käufer muss sich auf diese Informationen verlassen können, sonst sind sie nicht nur sinnlos, sondern irreführend. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Verkäufer hierdurch sogar arglistig getäuscht wird. Die Mehrzahl der Schiedsverfahren nach Unternehmenskäufen betreffen Fälle der fehlerhaften Aufklärung oder arglistigen Täuschung und nicht Fälle der unterbliebenen Aufklärung. Diese Ausgangslage verpflichtet den Verkäufer, die Richtigkeit seiner Auskünfte stets mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes zu recherchieren. Will oder kann er diesen Aufwand nicht treiben, muss er dies dem Käufer offenlegen. In dem meisten Fällen wird er dann doch vom Käufer zu einer ordentlichen Recherche gezwungen werden wird, falls er keine erhebliche Kaufpreisreduktion hinnehmen will. Käufer rechnen immer mit dem „worst case“.
Freizeichnung von der Haftung?
Viele Verkäufer neigen dazu, sich durch Verwendung geschickter Vertragsklauseln von genauen Nachforschungspflichten befreien zu wollen. Beliebt ist die Formulierung „nach bestem Wissen“, wodurch die objektive Richtigkeit der erteilten Informationen subjektiv verwässert werden soll. Gerne wird auch auf das „eigene“ Wissen des Verkäufers (oder Geschäftsführers) abgestellt, obwohl es evident ist, dass dieser – gerade in größeren Unternehmen – gar keine entsprechenden Detailinformationen besitzt. Der Verkäufer will damit dem Käufer letztlich nur den Nachweis einer fehlerhaften Aufklärung erschweren.
Zu einem fairen Geschäft gehört es, dass der Verkäufer dem Käufer einen objektiven und damit zutreffenden Einblick in das Unternehmen verschafft. So hat der BGH in mehreren Entscheidungen zum Ausdruck gebracht, dass sich der Verkäufer eines Unternehmens nicht mit seinem eigenen Unwissen herausreden kann, wenn er sich das entsprechende Wissen bei normalem Verlauf der Dinge hätte beschaffen können. Das Wissen von Mitarbeitern oder Vorgängern im Amt soll ihm einfach zugerechnet werden, wenn dieses Wissen denn wegen seiner besonderen Bedeutung hätte aktenmäßig erfasst und ihm zur Kenntnis gebracht werden müssen (Grundsatz des aktenmäßig zu erfassenden Wissens). Käufer sollten Wissenszurechnungs- oder Freizeichnungsklauseln, die den Verkäufer erkennbar von solchen Nachforschungspflichten befreien, nicht oder nur in eingeschränkter Form akzeptieren.
Do ut des
Umgekehrt sollte der Käufer akzeptieren, dass ihn selbst gewisse Nachforschungspflichten treffen, denn seine Due Diligence soll aus Sicht des Verkäufers auch den Sinn haben, die offengelegten Umstände außer Streit zu stellen. Die Informationserteilung an den Käufer dient nicht zuletzt der rechtzeitigen Identifizierung möglicher Garantieverstöße vor Abgabe der entsprechenden Garantien oder Zusagen im Kaufvertrag. Keinem Verkäufer kann daran gelegen sein, einen Unternehmenskaufvertrag abzuschließen, dem postwendend eine Haftungsklage des Käufers folgt. Zu empfehlen ist daher, die Bestätigung des Käufers einzuholen, dass diesem beim Abschluss des Kaufvertrages keine Garantieverletzung bekannt ist und er auf Geltendmachung von Ansprüchen wegen der ihm offengelegten Umstände verzichtet.
In diesem Zusammenhang sollte sich der Käufer auch das von seinen Mitarbeitern und Beratern erworbene Wissen wie eigenes Wissen zurechnen lassen. Er sollte mit Ansprüchen ausgeschlossen werden, die auf Tatsachen beruhen, welche ihm, seinen Mitarbeitern oder Beratern im Zuge der Due Diligence bekannt geworden sind. Der Verkäufer kann es schließlich nicht beeinflussen, wer in der Organisation des Käufers mit der Wissensbeschaffung beauftragt wird.
Abzuraten ist dagegen von Klauseln, die das Risiko, einen Sachverhalt aus den vorgelegten Informationen und Unterlagen tatsächlich zutreffend ermittelt zu haben, pauschal dem Käufer zuweisen. So kann versuchen manche Verkäufer beispielsweise eine „Vorkenntnis“ des Käufers von etwaigen Garantieverstößen zu fingieren, indem man den Käufer mit allen denkbaren Ansprüchen ausschließt, die sich aus den ihm offengelegten Informationen „ergeben können“. Bei einer solchen Formulierung würde der Käufer aber einseitig das Risiko tragen, einen (vielleicht versteckten) Sinnzusammenhang in den offengelegten Informationen übersehen zu haben, was mit echter Vorkenntnis nichts zu tun hat. Auch das Gesetz knüpft den Verlust der Haftungsansprüche nur an positives Wissen (echte Vorkenntnis) des Käufers oder zumindest an dessen grob fahrlässige Unkenntnis (§ 442 BGB).
Ein Käufer wiederum sollte, was immer wieder vorkommt, nicht darauf bestehen, dass ihm trotz Offenlegung von Informationen uneingeschränkt sämtliche Ansprüche wegen einer eventuell bereits entdeckten Garantieverletzung verbleiben sollen. Der Verkäufer muss darauf vertrauen können, dass der Käufer bereits entdeckte Garantieverstöße vor Vertragsschluss offenbart. Es liegt nicht im Interesse der Transaktionssicherheit, dem Käufer unerkannt Ansprüche für die Zeit nach dem Closing zu verschaffen.
Fazit
Bei der vorvertraglichen Aufklärung in einem Unternehmenskauf geht es stets um das Postulat der „open and honest communication“. Für Verkäufer und Käufer ist es gleichermaßen falsch und gefährlich, wichtige Informationen vor dem Vertragspartner zu „verstecken“ oder ein irreführendes Bild davon zu vermitteln. Es ist letztlich die Erfahrung aller Praktiker in diesem Geschäft, dass am Ende doch alles herauskommt (früher oder später). Durch Trickserei und vermeintlich schlaue Vertragsklauseln wird in der Regel für beide Vertragspartner mehr Schaden angerichtet als vermieden.